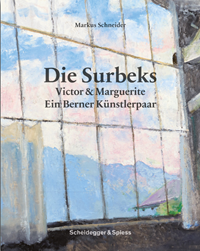Boris Blank sitzt im Garten vor seinem Tonstudio auf dem Züriberg. Er pfeift. Dann beisst er in einen Apfel, nimmt beide Geräusche mit seinem Smartphone auf und bastelt daraus binnen zwanzig Sekunden eine Melodie samt Takt. Die Software dazu kommt von Bos Blank himself. “Yellofier”, heisst seine App, die weltweit einige tausend mal heruntergeladen wurde: “Jedes Kind kann damit sein eigenes Lied komponieren. “
Die App hat hat auch seinen Erfinder verwandelt. Dank ihr gewann Boris Blank Freude an der Live-Präsentation. Seither geht er raus zu den Leuten. Vor Schulklassen im Zürcher Oberland und im Aargau gibt Anleitungen zum digitalen Musizieren. Dabei ist er ein Autodidakt, der Musiknoten schelmisch “Kügeli” nennt.
Am diesjährigen Jazzfestival in Montreux gab der scheue Boris Blank Blank zusammen mit dem forschen Dieter Meier das erste Konzert in der Schweiz - mit mit seinem Smartphone in der Hand. Niemand ahnte, wie froh Boris Blank war, dass er sich an diesem kleinen Ding festklammern konnte. Ohne App hätte er es nie geschafft, sich vor zwei tausend Menschen zu stellen. Mit App gab der Meister eine kurze Demonstration zum Do-it-yourself und brachte damit den Saal zum Lachen.
Am 30. November folgt die grösste Bühne der Schweiz: das Zürcher Hallenstadion. Boris Blank & Dieter Meier, sie bilden Yello, die einzige global erfolgreiche Schweizer Musikband, die bis heute zehn Millionen Schallplatten und CDs verkauft hat. Die halbe Welt tanzt zu ihrer Musik - obschon die beiden Schweizer Schöpfer bis jetzt konsequent waren - und nirgends live aufgetreten sind. Das liegt sicher nicht an Dieter Meier, sondern ganz allein an Boris Blank.
Wo liegt sein Problem? Boris Blank schüttelt den Kopf, er will die für ihn so traumatische Geschichte nicht noch einmal erzählen, sie ist nachzulesen im Buch “Yello” von Daniel Ryser. Es war der 2. Dezember des Jahres 1983 in der legendären Disco “Roxy” in New York. Blank und Meier umarmten und verneigten sich, das Publikum johlte- und niemand ahnte, was ein schlotternder Boris dem strahlenden Dieter ins Ohr flüsterte. “Nie wieder, Dieter, nie wieder werde ich auf der Bühne stehen”. Und Dieter antwortete: “Ich verspreche es Dir.”
Seit je bilden die beiden ein ungleiches Paar. Auf der einen Seite der geborene Performer. passionierte Pokerspieler und gefeierte Künstler Dieter Meier, der auf offener Strasse in New York einmal jedem Passanten einen Dollar überreicht hat - man musste nur “Ja” oder “Nein” zu ihm sagen. Die internationale Kunstwelt stand Kopf.
Auf der der anderen Seite, abseits vom Rummel, der Tüftler Boris Blank, der am liebsten einsam in seinem Tonstudio sitzt “wie ein Mönch in Klausur”, so Blank über Blank.
Der frühere Radio-Moderator Francois Mürner, der Yello in der Schweiz entdeckt hat, erinnert sich an die erste grosse Sendung mit Yello: “Boris Blank sprach zweieinhalb Worte, und Dieter Meier redete eine gefühlte halbe Stunde lang, ohne dass er sich ein einziges Mal unterbrechen lies.”
Wie harmonieren diese zwei so grundverschiedenen Typen musikalisch? “Symbiotisch wie ein Pilz mit seinem Baum”, antwortet Boris Blank. “Wir haben beide den gleichen Humor”.
Zum Beispiel spielte Boris eines düsteren Nachmittags eine simple Melodie vor und sagte zu Dieter: “Stell dir vor, du liegst in der Karibik in einer Hängematte am Strand, einen Drink in der Hand, was sagst du?” - “Oh Yeah”, antwortete Dieter Meier. Immer und immer wieder musste Dieter diese beiden Worte neu aufsagen: Oh Yeah. Oh Yeah. Oh Yeah. “Daraus kannst du doch kein Lied machen”, meinte Dieter.
Am nächsten Tag fand es Meier ganz lustig und ergänzte seinen einsilbigen Text mit mit den Worten “ Mond”, “ Sonne”, “schön” und “noch schöner”. Auf englisch: “The moon, beautiful, the sun, even more beautiful. Oh Yeah.” Hunderte Millionen Mal gehört, zehntausendfach eingesetzt von “Die Simpsons”-Trickfilmen bis “Gran Turismo 4” auf der Playstation.
Nur live gabs bislang kein O Yeah, wenigstens nicht von Yello im Original. “Ein Maler stellt sich auch nicht auf die Bühne und schwingt seinen Pinsel vor dem Publikum”, sagt Boris Blank, der digitale Pianist.
Seine notorische Ehrfurcht hat er nun abgelegt. Zuerst die App, dann Montreux, kurz vorher schon drei Konzerte in Berlin total ausverkauft: so etwas gibt Selbstvertrauen.
Fröhlich bittet Boris Blank die Gäste ins Untergeschoss von Dieter Meiers Villa. Bevor er sich hier in seinem Tonstudio befragen lässt, rätselt er, ob der Journalist aufgrund seines Dialekts eher aus Sissach stammt oder aus Liestal (stimmt). Und als der Fotograf, eingewandert aus dem Piemont, auf Berndeutsch switcht, freut sich der Zürcher diebisch. Blank selber beherrscht fast jedes Schweizer Idiom, “nur Walliserisch isch bockig”.
Fotografieren lässt er sich am liebsten von links, so sieht man sein Doppelkinn weniger gut. Zwei Sonnenbrillen hat er parat, weil sein linkes Auge wieder mal entzündet ist. Was davon kommt, dass er sein linkes Auge als Bub selber zerstört hat: beim Zünslen mit einer Patrone, die er aus dem Waffenschrank seines Vaters geklaut hatte.
Auch aus seinem Privatleben macht er kein Geheimnis. Er wohnt unten in der Stadt in einer normalen Wohnung, seine Tochter Olivia hat im März die Matur bestanden, verheiratet ist er mit Patrizia Fontana, die einen Laden führt mit den “besten Ravioli nördlich vom Gotthard”, urteilt Gourmet Blank. In Zürich ist Patrizia Fontana stadtberühmt, als Tänzerin ist sie weltbekannt. In fast jedem Yello-Video tritt sie auf, in einem spielt sie die Hauptrolle zusammen mit ihrem Ehemann. Boris, heute 65, damals 29, halb Gigolo, halb Clown, zwinkert und zuckt. Patrizia, damals 25, lockt ihn in ihren Cabrio. Sie fährt gefährlich, Boris weis es, aber er braucht es, essentiell, sensentiell: “I love you”. Ein Welthit.
“Yello ist wie eine Familie”, sagt Boris Blank. Dieter Meiers Töchter Sophie, Eleonore und Anna tanzen in den Videos, Dieter Meiers Sohn Francis ebenfalls. Dieter Meiers Frau Monique, die in der Zürcher Altstadt eine Boutique führt, hat für Modeschauen in Paris schon Yello angeheuert - zu Zeiten, als Boris Blank noch auf keinen Fall live auftreten wollte. Für Monique machte er Ausnahmen, abseits von der Musikszene,fühlt er sich wohler, dort zeigt er sich mit Facetten, wie man ihn aus den Yello-Videos kennt. “Ein Komiker auf dem Niveau der Marx Brothers”, so kennt ihn Dieter Meier.
Erfunden wurde alle ersten Songs und Videos fernab von Glanz, Gloria und Hollywood im alternativen Kulturzentrum “Rote Fabrik” in Zürich Dort konnte Dieter Meier zu Beginn der 80er Jahre ein Atelier mieten, das der Künstler für den “Tüftler” in ein Tonstudio umbauen liess: “Tüftler”, so wird Blank in dene Medien stereotyp genannt. Tontüftler.
Sein erstes Instrument war ein Revox-Tonband, mit dem er Rückkopplungen und Echos produzierte. “Sobald es Hall gibt, kribbelt es in mir”. Er sei ja gar kein richtiger Musiker”, sagt der Elektroniker Boris Blank. “Ich arbeite mit Geräuschen und schaffe Stimmungen”. Rieselt das Wasser aus einer Spritzkanne, hört er eine Symphonie.
Eines Tages bat Boris Blank bei Dieter Meiers Vater, den Bankier, um einen Kredit in Höhe von 100’000 Franken. Investiert wurde das viele Geld in ein revolutionäres Musikinstrument unter der Marke Fairlight CMI: den ersten digitalen Synthesizer mit Sampling-Technik. 1980 erschien die erste Yello-Single “Bostich” samt Video: ein Mix zwischen Techno und Rap, musikalisch der Zeit weit voraus, filmisch untermalt mit Charlie Chaplins “Modern Times”:
Bald kamen die ersten Telefone aus New York: “Wisst ihr eigentlich, was hier abgeht?” Blank und Meier flogen hin und trauten in der famosen Disco “Roxy” ihren Augen nicht: die Leute tanzten beim zweiten Mal “Bostich” noch wilder als beim ersten Mal.
Drei Jahre später, als sie im selben “Roxy” live auftraten durften - erlebte Boris Blank sein Trauma:“Nie wieder”.
Zum ersten Mal “rückfällig” wurde er 1999, als Yello für die World Music Awards in Monaco nominiert waren. Jetzt ging es nicht anders, jetzt musste er eine kurze Einlage bieten. Beim Soundcheck im “Monte Carlo Sporting Club” sass ein Mann mit blauem Jackett allein in der hintersten Reihe. “Nice to meet you”, begrüsste ihn Boris Blank. “Ich bin es, der sich freut”, antwortete der Typ, der sich ohne Sonnenbrille als Ringo Starr von den Beatles entpuppte - und der Boris Blank etwas derb in den Himmel lobte: “Fucking brilliant”.
Am 30. November im Hallenstadion nun folgt die ganz grosse Show. Boris Blank tut noch, als ob er keinen Bammel hätte. Er wird sich auch diesmal an sein Smartphone klammern, seine App präsentieren - und viel mehr: Für 77 Franken pro Stehplatz, 252 Franken für den besten Sitzplatz muss Yello eine wahrhaftige Show bieten: Mit wirklicher Musik von fünf echten Bläsern, zwei Drummern, einem Gitarristen und vier Sängerinnen im Chor. Dieter Meier singt und tanzt, Boris Blank spielt am Sampler den “Kapellmeister”, wie er selber sagt. Und er wird, was er sich sich sein Leben nie zugetraut hätte, ein ganzes Lied ganz allein singen.
“Man muss so etwas noch machen , solange man jung ist”, sagt Boris, der seit Anfang Jahr AHV-Rente bezieht.
Dieser Text erscheint in redigierter Form in der neuen Nummer der "Schweizer Familie"
Dieser Text erscheint in redigierter Form in der neuen Nummer der "Schweizer Familie"